Digitalisierung im Gesundheitswesen
Wenn Daten heilen sollen – und Vertrauen auf dem Prüfstand steht
Seit dem 1. Oktober 2025 müssen Ärztinnen, Ärzte und Psychotherapeut:innen die elektronische Patientenakte (ePA 3.0) aktiv befüllen. Die Reform soll Versorgung und Transparenz verbessern – zeigt aber, wie groß die Kluft zwischen digitalem Anspruch und realer Umsetzung bleibt.
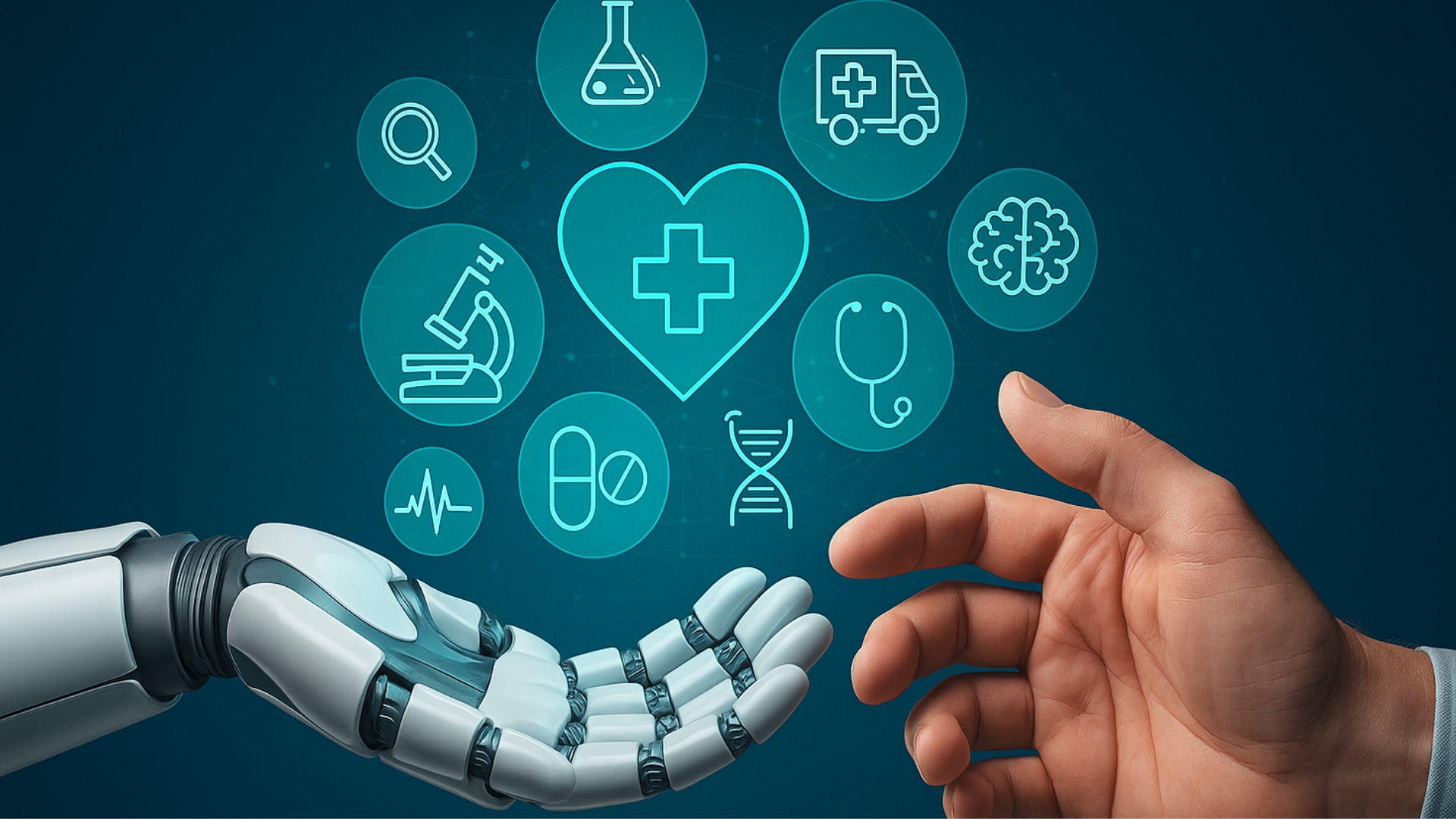
Digitalisierung mit Anlaufschwierigkeiten
Mit dem Start der ePA 3.0 hat das deutsche Gesundheitswesen eine neue Phase digitaler Verantwortung erreicht. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass der Übergang alles andere als reibungslos verläuft. Laut aktuellen Erhebungen verfügen rund 57 Prozent der Arztpraxen über ein voll funktionsfähiges ePA-Modul, in Kliniken liegt der Anteil noch niedriger. Technische Probleme, fehlende Updates und Schnittstellenfehler führen vielerorts zu Verzögerungen beim Hochladen medizinischer Dokumente.
Die politische Zielsetzung bleibt ehrgeizig: Eine flächendeckend verfügbare, interoperable Patientenakte, die Diagnosen, Befunde und Medikationen sicher zusammenführt. Doch der Alltag zeigt ein anderes Bild. Praxen und Softwareanbieter arbeiten unter hohem Druck, Versorgungsprozesse geraten ins Stocken. Die Erwartung, dass sich Effizienz und Datenschutz reibungslos verbinden lassen, stößt an Grenzen.
Für Patient:innen ist die ePA bislang kein selbstverständlicher Teil der Versorgung. Nur etwa 15 Prozent nutzen sie aktiv, vor allem aufgrund mangelnder Nutzerfreundlichkeit und begrenzter Information. Die technische Basis existiert, aber Vertrauen und Akzeptanz wachsen deutlich langsamer als die Datenmenge.
Künstliche Intelligenz als neuer Faktor
Parallel zur elektronischen Akte entwickelt sich der Einsatz von künstlicher Intelligenz zu einem der dynamischsten Felder im Gesundheitswesen. In mehreren Regionen laufen Pilotprojekte, die zeigen, wie Algorithmen Diagnosen und Therapien unterstützen können. In Lübeck werden unter dem Projektnamen AI-CARE Krebsregisterdaten aus mehreren Bundesländern verknüpft, um Muster zu erkennen und Prognosen zu verbessern. In Chemnitz wird mit PRIME eine KI-gestützte Entscheidungsplattform für Onkolog:innen erprobt, die patientenspezifische Behandlungsoptionen vorschlägt. Das Netzwerk Health.AI Saar testet KI-Modelle zur Prozessoptimierung in Kliniken und Laboren.
Auch die Radiologie profitiert: Systeme analysieren CT- und MRT-Bilder mit wachsender Präzision, reduzieren Fehlinterpretationen und verkürzen Auswertezeiten. Erste Studien zeigen Effizienzsteigerungen von bis zu 30 Prozent. Gleichzeitig wächst die Abhängigkeit von Datenqualität und technischer Zuverlässigkeit.
Die neue EU-KI-Verordnung, die Anfang 2026 vollständig greift, ordnet medizinische KI-Systeme künftig nach Risiko- und Transparenzklassen. Hersteller müssen offenlegen, mit welchen Datensätzen ihre Modelle trainiert werden und wie Diskriminierungen ausgeschlossen werden. Deutschland setzt dabei auf eine sogenannte „Health-Sandbox“, um Innovationen innerhalb klar definierter Sicherheitsgrenzen zu ermöglichen.
Damit entsteht ein Spannungsfeld zwischen Datenschutz, technischer Machbarkeit und regulatorischem Anspruch. Fortschritt wird zur Frage der Governance: Wer die Daten hat, bestimmt die Richtung – aber wer sie schützt, erhält das Vertrauen.
Fortschritt braucht Verantwortung
Digitalisierung und künstliche Intelligenz verändern das Fundament des Gesundheitswesens. Doch Technologie allein genügt nicht. Entscheidend ist, ob die Systeme verlässlich, erklärbar und sicher sind – und ob sie das Vertrauen der Menschen gewinnen. Die ePA-Pflicht markiert einen Wendepunkt: Sie zwingt das System, Verantwortung neu zu definieren – technisch, organisatorisch und ethisch.
Deutschland steht damit vor einer doppelten Aufgabe: den Rückstand aufzuholen und zugleich die Standards zu setzen, an denen sich andere messen lassen müssen. Nur wenn Datenschutz, Innovation und Versorgungsqualität gemeinsam gedacht werden, kann aus der Digitalisierung ein Fortschritt entstehen, der tatsächlich heilt.
